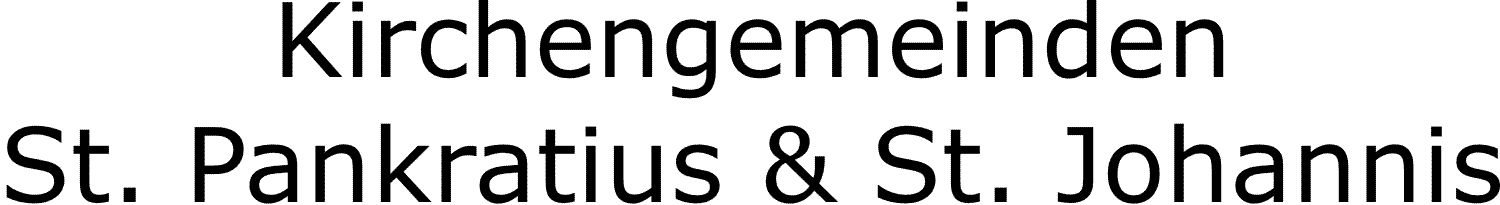414 5nach6_31.01.25_Prüfen auf Hoffnung
„Prüfet alles und das Gute behaltet“ (1. Brief an die Thessalonicher 5, 12) – unsere Jahreslosung beschäftigt mich. Ich habe mich gefragt, warum das so ist.
Vielleicht hat es etwas mit meinem – früheren – Beruf zu tun. Wie oft bin ich als Schüler geprüft worden?! Und - vor allem – wie oft habe ich Schüler/innen geprüft?! Angefangen beim Abfragen von Gedichten über freitägliche Kontrollen zu Unterrichtsinhalten der Woche, Tests, Klassenarbeiten bis hin zu schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfungen.
Bei all dem Prüfen hatte ich selten ein gutes Gefühl. Ich wusste ja, dass jede Zensur auch die zukünftigen Lebensmöglichkeiten meiner Schüler/innen mehr oder weniger stark beeinflussen würde.
Die Beeinflussung von Lebenschancen über die Zensuren ist leider bei vielen Prüfungen der einzige Bezug zur Zukunft. Inhaltlich bezogen sich die Prüfungen ja meistens auf die Vergangenheit, auf das, was „dran gewesen“ war.
Natürlich brauchte es Grundwissen z.B. in der Rechtschreibung und der Aufsatzlehre. Aber leidlich wohl gefühlt habe ich mich immer erst, wenn ich in Prüfungen einen Zukunftsbezug herstellen konnte: Bewerbungen schreiben, einen Antrag auf einen Personalausweis ausfüllen, einen Vertrag verstehen oder eine Reklamation schreiben können.
Wie ist das mit dem Prüfen in unserer Jahreslosung. Zunächst überwog in meinem Verständnis die Orientierung an Vergangenheit und vielleicht noch an der Gegenwart. Ich soll prüfen, ob das, was mir in der Vergangenheit und gerade jetzt in der Gegenwart widerfahren ist, ob das gut ist. Und wenn es gut ist, soll ich es behalten.
Aber wofür? Um es aufzuheben, auszustellen, mich an ihm zu erfreuen? Das wäre mir zu wenig!
Es soll doch beim Prüfen um Zukunft gehen! Zumindest soll das Prüfungsergebnis, also der Befund, dass etwas gut ist, Hoffnung für eine gelingende Zukunft stiften. Es soll mich getrost und gestärkt auf den Weg in die Zukunft gehen lassen!
Aber wie ist es um die Hoffnung bestellt in dieser Zeit?
Kai heißt nicht wirklich Kai. Aber alles, was jetzt kommt, stimmt. Kai hatte Schwierigkeiten mit seiner unvollständigen Familie, mit sich und nicht zuletzt auch deswegen mit meinem Deutschunterricht. Persönlich haben wir uns ganz gut verstanden. Und so versuchte ich, ihn nach einer weiteren Fünf in der Deutscharbeit zu trösten. „Kai, wir schreiben ja noch eine Arbeit vor den Zeugnissen. Und bedenke: Die Hoffnung stirbt zuletzt!“ Kai antwortete: „Ja, Herr Gräbig, aber dann stirbt sie auch.“
Und mit diesem Blick auf die Hoffnung versiebte Kai auch die nächste Arbeit.
Es kommt offensichtlich nicht nur darauf an, dass man hofft. Es kommt auch darauf an, wie man hofft! Ein Beispiel:
Ein schottisches Mütterchen geht jeden Tag in die Kirche und betet zu Gott: „Lieber Gott, … der du allmächtig bist und alle Dinge lenkst, erbarme dich meiner und gib mir den Jackpot im Lotto!“ So geht das Tage, Wochen, Monate und Jahre. … Eines Tages öffnet sich plötzlich der Himmel und eine Stimme spricht: „Bitte gib mir eine Chance – kauf dir endlich einen Lottoschein!“ (Andere Zeiten e.V., Oh – noch mehr Geschichten für andere Zeiten, Hamburg, 2017, S.31)
Es geht also nicht nur um ein einfaches Hoffen, es geht um ein aktives Hoffen!
Unser Leben ist gerahmt von zwei großen Zusagen.
Die eine Zusage ist die Taufe. Das Bewusstsein, getauft zu sein, von Gott gesehen und wertgeschätzt zu sein, das ist – gut geprüft - gut und es tut gut.
Die andere Zusage ist die Verheißung der Überwindung des Todes hin zu einem Sein in der liebevollen Geborgenheit Gottes
Das ist ein durchaus hoffnungsstiftender Rahmen für unser Leben. Diesen Rahmen gilt es allerdings auszufüllen, zu gestalten – voller Hoffnung, aber eben aktiv.
Nun kennen wir das Sprichwort „Hoffen und harren hält manchen zum Narren“. Das alte Wort „harren“ kennen wir kaum noch, vielleicht das verwandte „Verharren“. Wer verharrt wartet still ab, was geschieht. Ja, diese Hoffnung hält manchen zum Narren, denn dann kann sich Hoffnung oft nicht erfüllen.
Aber auch mit der aktiven Hoffnung ist das nicht so einfach. Jesus z.B. wusste das. Er erzählt (Mk 4, 14-20):
14Der Bauer sät das Wort Gottes aus.
15Ein Teil davon fällt auf den Weg. Er steht für die Menschen, die das Wort hören, wenn es gesät wird. Aber sofort kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät wurde.
16Ein anderer Teil fällt auf felsigen Boden. Er steht für die Menschen, die das Wort hören und es sofort mit Freude annehmen. 17Aber es schlägt keine Wurzeln in ihnen, weil sie ihre Meinung schnell wieder ändern. Wenn ihnen das Wort Schwierigkeiten oder Verfolgung bringt, lassen sie sich sofort davon abbringen.
18Noch ein anderer Teil fällt zwischen die Disteln. Er steht für die Menschen, die das Wort zunächst hören. 19Aber dann kommen die Alltagssorgen, der Reiz des Geldes oder die Gier nach irgendetwas anderem. Sie ersticken das Wort, und es bringt keinen Ertrag.
20Aber ein Teil wird auch auf guten Boden gesät. Er steht für die Menschen, die das Wort hören und aufnehmen. Bei ihnen bringt es viel Ertrag ...«
Nehmen wir für das ausgesäte „Wort Gottes“ das Wort „Hoffnung“ – und das passt ja durchaus – dann haben wir hier genügend Beispiele, wie Hoffnung verdorren kann, zunichte gemacht werden kann.
Es gibt diese Momente, in denen uns die Welt unerbittlich hoffnungslos erscheint. Krisen und Konflikte türmen sich auf … und wir sollen (trotz allem) einen Weg nach vorne finden. … Der Theologe Cornel West sagte einmal: „Ich kann kein Optimist sein, aber ich bin ein Gefangener der Hoffnung. Ein Gefangener – was für ein kraftvolles Bild. Diese Hoffnung, von der West spricht, ist keine naive Leichtigkeit nach dem Motto ‚Don’t worry, be happy“. Sie ist eine Entscheidung, eine bewusste Bindung an das Leben, auch wenn alles dagegen sprechen zu scheint. … Es ist eine Hoffnung, die auf dem Leiden und der Ungerechtigkeit dieser Welt gründet, aber nicht daran zerbricht. Sie fordert dazu auf, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, sich dem Leid der Menschen nicht zu verschließen, sondern es mitzutragen – und in all dem das leise, beharrliche Versprechen zu sehen, dass das letzte Wort immer der Auferstehung gehört. …
Um an die Auferstehung zu glauben, muss man das Schweigen und die Dunkelheit des Grabes ausgehalten haben. Hier ist unsere Hoffnung nicht einfach ein optimistischer Ausblick, sondern eine Kraft, die durch die Dunkelheit hindurch trägt.
Dieses Jahr beginnen wir vielleicht erneut mit Zweifeln, mit Sorge um die Welt, um unsere Zukunft. Doch auch in diesem Jahr stecken Momente, die uns überraschen und tragen werden. Dafür müssen wir unseren Blick schärfen, prüfend auf sie schauen und das Gute bewahren, ganz wie die Jahreslosung empfiehlt.
Vielleicht entdecken wir bei unserem Prüfen, dass die alten Muster nicht mehr greifen (oder wir entdecken sie neu!) und dass Veränderung zum Guten langsamer kommt, als wir es wünschen – aber sie kommt.
Wenn wir uns auf diese Wagnis-Hoffnung einlassen, lernen wir, dass es uns alle braucht, um – im Kleinen wie im Großen – eine Welt zu schaffen, die gerechter, liebevoller, und heilvoller ist. Jede und jeder von uns trägt einen Teil dazu bei, auch in den kleinen Entscheidungen und Handlungen des Alltags, die oft übersehen werden.
So gehen wir in das neue Jahr nicht unbedingt voller Optimismus, aber mit einer Hoffnung, die uns nicht loslässt. Mi einer Hoffnung, die uns aufruft, das vermeintlich Selbstverständliche oder Unabänderliche zu prüfen und zu hinterfragen und nach einem Weg zu suchen, der uns miteinander verbindet. Dabei dürfen wir wissen, dass jede Tat der Liebe in Richtung Gerechtigkeit, jede Entscheidung für gelingendes Leben uns dem Versprechen der Auferstehung näher bringt – und zwar auch schon vor dem Tod
(aus: Quinton Ceasar, Vom Wagnis Hoffnung, in: Andere Zeiten e.V., Andere Zeiten – Magazin zum Kirchenjahr, Hamburg, 1/25, S.5)
Der Religionspädagoge Fulbert Steffensky, sagt: Die Hoffnung gibt sich nicht geschlagen. Sie ist vielleicht die stärkste der Tugenden, weil in ihr die Liebe wohnt, die nichts aufgibt, und der Glaube, der in der Nacht schon den Tag sieht ...
Die Aufgabe der Kirchen heute wäre, wie die ersten Christen diese Hoffnung in die Welt auszustrahlen, anstatt sich mit sich selbst zu beschäftigen. Wenn wir Hoffnung ausstrahlen, dann werden wir in dieser hoffnungsarmen Zeit zum Sauerteig der Hoffnung für unsere Gesellschaft ... (A.Grün, G.Hänsel, Kirche als Sauerteig der Hoffnung, Ev. Zeitung 12.01.25, S.3)
Es ist wie in jenem Laden:
Ein junger Mann betrat im Traum einen Laden. Hinter der Theke stand ein Engel.
Hastig fragt er ihn: “Was verkaufen Sie, mein Herr?” Der Engel antwortete freundlich: “Alles, was Sie wollen.”
Der junge Mann begann aufzuzählen: “Dann hätte ich gern das Ende aller Kriege in der Welt, bessere Bedingungen für die Randgruppen der Gesellschaft, Beseitigung der Elendsviertel in Lateinamerika, Arbeit für die Arbeitslosen, mehr Gemeinschaft und Liebe in der Kirche und … und …”
Da fiel ihm der Engel ins Wort: “Entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch verstanden.
Wir verkaufen keine Früchte, wir verkaufen nur den Samen.” (vgl. Andere Zeiten e.V., Oh – noch mehr Geschichten für andere Zeiten, Hamburg, 2017, S.39)
Mit der Zusage der Liebe Gottes und Jesu Bildern vom gelingenden Leben haben wir den Samen. Verlassen wir den Laden mit den Sämereien enttäuscht, ohne etwas mitzunehmen – oder nehmen wir Samentüten mit, säen aus und gärtnern hoffnungsvoll und aktiv.