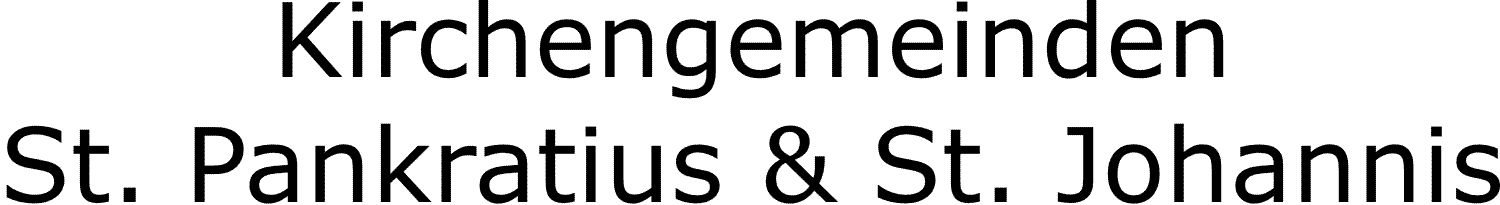436 5nach6_15.08.25_Heimat 2 Ps 23
Quelle: Beate Mitzscherlich, Eigentlich sind wir Nomaden, in: Andere Zeiten e.V. (Hg.), Anders handeln 2/2025, Hamburg, 2025, S.9ff, Zitate kursiv
Schaut man in die Zeitung oder ins Fernsehen, hört man in die Gespräche der Menschen hinein, da fällt eines immer wieder auf: Angesichts so vieler Veränderungen im Großen wie im Kleinen fühlen sich nicht wenige heimatlos und unbehaust. Oft beginnen solche Sätze mit „Das ist nicht mehr …“ und dann kann man wahlweise einsetzen Familie, Dorf, Gemeinde, Land, Land u.a.m.
Dabei hat das Heimatlos-Sein durchaus Tradition – im Alten wie im Neuen Testament. Und in mancher Heimatlosigkeit steckt vielleicht ja auch ein Aufbruch, eine Entdeckung.
Für viele war und ist es die Trennung von vertrauten Orten, die das Gefühl der Heimatlosigkeit auslöst. Aber – ist Heimat nur ein Ort?
Die Psychologin Beate Mitzscherlich sagt: Von unserer Geschichte und unserer biologischen Ausstattung her sind wir ja eher Nomaden!
Sie nennt zunächst die Herkunftsheimat. Damit verbindet sie Kindheit und Aufwachsen, Familie und Freunde, die … Landschaft, den Wald, aber auch den Dialekt.
Sie findet aber auch, dass es mehrere Heimaten geben muss. … Nicht jeder hat oder braucht einen festen Ort … Was wir aber schon brauchen, ist so etwas wie ein Heimatgefühl. Ein Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und Zugehörigkeit, von „Ich kenne mich aus“, „Ich weiß, wie es geht“. Das machen Menschen an Orten fest … vor allem aber an sozialen Beziehungen.(S.9)
Natürlich kann diese Vertrautheit auch zu einer Über-Vertrautheit führen, zu dem Gefühl von Kontrolliert-Sein, Festgelegt-Sein und Enge.
Mitzscherlich sagt: Die Jugend wird ja ganz klassisch als Lehr- und Wanderjahre gesehen. Man muss eben auch mal über die eigene Herkunft, das Vertraute und Gewohnte hinausgehen, um eine eigene Identität, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln.(S.10)
Heimat kann auch ganz losgelöst von einem bestimmten Ort sein. Sie ist dann irgendwo, immer wieder neu oder woanders, wo man Menschen findet, denen man sich verbunden fühlt. (S.10) So können wir einander Heimat schaffen, einander zur Heimat werden.
Wer umzieht, macht Heimat nicht unbedingt am neuen Wohnort als Ganzem fest. Manche erschließen sich eine Stadt oft durch Gehen oder Radfahren, weil man sich so räumlich und körperlich mit dem neuen Ort verbindet. Wichtig sind auch ‚Ankerpunkte‘ wie ein Stammcafè … oder Bäcker oder Friseurin ... Hilfreich ist außerdem, sich in eine neue Gemeinschaft hineinzubegeben. (S.12)
Mitzscherlich hat einem ihrer Bücher den Titel gegeben „Heimat ist das, was ich mache“. Ihre Grundidee ist, dass ich mich in einer Gesellschaft, die sich schnell ändert, immer wieder neu beheimaten muss. Ich muss dafür meinen Ort noch nicht einmal verlassen, er ändert sich auch so … Heimat ist auch etwas, was sich ständig wandelt.
In ihren Forschungen – Mitzscherlich ist Professorin– gab eine ganze Reihe von Menschen das Gefühl einer inneren Heimat an… Sie sagten: Ich habe eine innere Heimat, die kann mir keiner nehmen, egal, wo ich bin. Religion spielt hier eine wichtige Rolle.
Als ich diesen Satz gelesen hatte, stutzte ich und wurde sehr nachdenklich. Ist dieser psychologisch geprägte Text vielleicht auch ein theologischer Text, ein Text, der für Kirche und Gemeinde interessant, ja, wegweisend sein kann?
Was kann, was muss geschehen, damit Menschen in der Kirche Heimat finden, sich in der Kirche beheimatet fühlen können. Damit meine ich nicht nur den Kirchort, das Kirchengebäude und das Gemeindehaus, damit meine ich auch Beziehungen, Begegnungen, Gruppen, Erfahrungen. Ich meine auch Gedanken, Ansichten und Haltungen …
Heimat ohne konkreten Ort. Heidi Hauke und Hannchen Loss, die beide aus unserer Gemeinde weggezogen sind, werden in dem Ort Bodenburg und in Berlin vielleicht nicht heimisch, aber sie fühlen sich im Zusammensein mit bestimmten Menschen geborgen und beheimatet. Ortlose Beheimatung.
Ein Beispiel für so eine ortlose Beheimatung ist die alttestamentliche Erzählung von Ruth und Naomi (Ruth n1, 1-22)
Der Bauer Elimelech und seine Frau Naomi aus Bethlehem brachen mit ihren zwei Söhnen … ins Nachbarland Moab auf, weil in ihrer Heimat Bethlehem eine Hungersnot herrschte. … dort gründeten eine neue Existenz. Nach einiger Zeit heiratete der eine Sohn die Moabiterin Ruth. Der andere Sohn heiratete die Moabiterin Orpa. Ruth und Orpa wurden herzlich in die Familie aufgenommen. Nicht lange danach starb Elimelech .... Der eine Sohn starb wenig später an einem Fieber. Kurz danach verunglückte auch der andere Sohn tödlich. Die drei Frauen, Naomi mit ihren Schwiegertöchtern Ruth und Orpa, blieben alleine zurück. Ihre Existenz war bedroht. Denn Frauen waren ohne Männer an ihrer Seite rechtlich und wirtschaftlich weder abgesichert noch geschützt. Als sei nicht schon genug Unglück geschehen, brach nun auch in Moab eine Hungersnot aus. Da entschied Naomi, wieder in ihre Heimat Israel zurückzukehren.
Naomi bereitete alles vor und eines Tages brach sie auf, .... Ihre Schwiegertöchter begleiteten sie bis an die Grenze zwischen Moab und Israel. Dort kam es zur entscheidenden Wegkreuzung. Sie wurde für die drei Frauen zur Lebenskreuzung. Naomi bat ihre beiden Schwiegertöchter wieder nach Moab zurückzukehren. Sie sollten sich andere Männer suchen, um ihre Existenz zu sichern. Orpa drehte darauf nach kurzer Überlegung weinend um und kehrte nach Moab zurück. Ruth entschied sich anders. Sie versprach Naomi, bei ihr zu bleiben und ihr treu zu dienen. Ruth entschied sich damit für ein Leben mit Naomi, obwohl sie wusste, dass zwei Witwen alleine ohne Männer in jener Zeit kaum überlebensfähig waren.
Ruth sagte zu Naomi:
"Überrede mich nicht, dich zu verlassen. Ich will mit dir gehen. Wo du hingehst, will ich auch hingehen, und wo du lebst, will ich auch leben. Dein Volk wird mein Volk sein und dein Gott wird mein Gott sein. Wo du stirbst, will ich auch sterben, und dort will ich begraben werden. Gott tue mir dies und das, nur der Tod wird mich von dir scheiden." (Ruth 1,16)
Der Ausspruch von Ruth gegenüber ihrer Schwiegermutter Naomi ist bemerkenswert. Er ist ein starkes Zeichen von Liebe, Verbundenheit und Fürsorge. Er klingt wie der Treueschwur einer Liebenden. Tatsächlich ist dieser biblische Text aus dem Buch Ruth im Laufe der Zeit bis heute einer der beliebtesten (heterosexuellen) Trausprüche geworden. Er wird bei kirchlichen Trauungen oft verwendet. Zumeist wird er allerdings zitiert, ohne dass die Beteiligten den Zusammenhang kennen. Die wenigsten wissen, dass der Text eigentlich ein Treueschwur von einer Frau zu einer anderen ist. (Ruth und Naomi | evangelisch.de)
Sogar Bertolt Brecht hat diesen Satz in seine Dreigroschenoper aufgenommen. Er wird darin von Polly Peachum an ihren Mann Mackie Messer gerichtet.
Heimat finden in einer Beziehung. Bei Ruth und Naomie ist es gleich eine mehrfache Beziehung:
Es ist eine persönliche Beziehung.
Es ist eine dynamische Unterwegs-Beziehung, sie wollen einen Weg zusammen „gehen“.
Es ist eine ortsbezogene Beziehung („Wo du lebst“).
Es ist eine soziale, gruppenbezogene Beziehung („Dein Volk wird mein Volk sein“).
Es ist eine religiöse Beziehung („dein Gott wird mein Gott sein“).
Und all das können wir, wenn es gut läuft, in einer Kirchengemeinde finden.
Der Generalsekretär des Gustav-Adolf-Werkes schreibt: „Mit dem wandernden Gottesvolk ist … die Kirche in der Welt unter Anfechtungen und Gefahren. Es ist die lebendige Kirche, die gegenüber einer verfestigten und verweltlichten Kirche das Evangelium lebendig zu erhalten hat. Es ist ihre Aufgabe, Stadt auf dem Berg, Licht der Welt und Salz der Erde zu sein. Die etablierten, gefestigten Kirchen sind daran zu erinnern, dass sie Volk Gottes auf der Wanderschaft sind.“ (Evangelische Diaspora 1964, 35. Jg, S. 39f)
Und Ruth und Naomi können uns dabei gute Weggenossinnen sein!