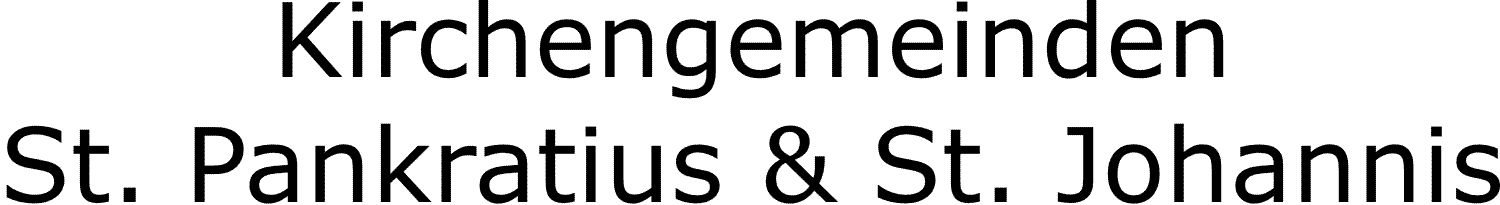400_5nach6_01.11.24_Immerwährende Reformation Ps 71
Der Reformationstag liegt gerade hinter uns. Interessant, welche Bedeutungsbreite dieser grundlegende Begriff der protestantische Kirchen hat: Wenn man den lateinischen Ursprung wörtlich nimmt, geht es um die Wiederherstellung einer Form, die sich verändert hat. Also etwas wie „zurück zu den Wurzeln“. Luthers „Reformation“ hatte sicher auch dieses konservative Element, aber es ging ihm und den anderen Reformatoren vor allem um eine Umgestaltung i.S. einer Erneuerung mit dem Ziel einer Verbesserung.
Die wesentlichen Punkte der Reformation, die auch heute noch gemeinsamer Nenner der aus ihr hervorgegangenen protestantischen Kirchen sind, werden oft mit den sogenannten vier soli (lat. solus „allein“), zum Ausdruck gebracht:
sola gratia: Allein durch die Gnade Gottes wird der glaubende Mensch errettet, nicht durch seine Werke.
sola fide: Allein durch den Glauben wird der Mensch gerechtfertigt, nicht durch gute Werke.
sola scriptura: Allein die Schrift ist die Grundlage des christlichen Glaubens, nicht die kirchliche Tradition.
solus Christus: Allein die Person, das Wirken und die Lehre Jesu Christi können Grundlage für den Glauben und die Errettung des Menschen sein.
Jede Reformation muss sich im Grunde an diesen vier Grundsätzen messen lassen.
Zu den Erkenntnissen der Reformationszeit gehört die lateinische Formel „ecclesia semper reformanda“ – Kirche ist immer zu verändern. Danach ist Reformation, ist Veränderung, Erneuerung mit dem Ziel der Verbesserung eine ständige Aufgabe. Das war eine wesentliche Erkenntnis des – katholischen! - Zweiten Vatikanischen Konzils (1962). Die Formel stammt ursprünglich aus der Reformationszeit, vermutlich von Jodocus van Lodenstein (1620–1677), einem holländischen Prediger. So ist der Reformationstag nicht nur ein kirchengeschichtlicher Erinnerungstag, sondern immer auch Anlass für eine aktuelle Bestandsaufnahme und Entwürfen für die Zukunft.
Deshalb will ich heute einmal schauen auf die Veränderungen, die ich selbst in den gut 30 Jahren in unserer St.Johannis-Gemeinde hier in Königsdahlum erlebt habe. Sie sind in Vielem kleiner und unbedeutender als die umstürzenden theologischen Erkenntnisse und innerkirchlichen Veränderungen Martin Luthers. Aber auch sie dienen dem Ziel, dass eine Kirchengemeinde funktioniert, damit die biblische Botschaft von der Gnade Gottes und der Rechtfertigung dessen, der an Jesus Christus glaubt, unter die Leute kommt.
Im traditionellen Kirchenverständnis steht der sonntägliche Gottesdienst im Mittelpunkt, alles andere sortiert sich drumherum. Nun kann vom sonntäglichen Gottesdienst in St.Johannis schon lange keine Rede mehr sein. Nur am ersten Sonntag im Monat – und nur dann - trifft sich relativ früh ein überschaubar gewordener Kreis überwiegend älterer Gemeindeglieder zu einem Gottesdienst, den man nicht wirklich als Mittelpunkt des Gemeindelebens bezeichnen kann. Er ist ein Teil neben anderen.
Interessant ist, dass sich das gottesdienstliche Angebot ausgeweitet hat. Seit 2009 haben wir 5nach6 als freitägliche Andacht. Großer Beliebtheit erfreuen sich die sommerlichen Gottesdienste auf dem Weinberg. Und mit den vierteljährlichen Taize-Andachten gibt es seit kurzem noch eine neue Form.
Gern besucht werden Gottesdienste, die sich vom traditionellen Hauptgottesdienst unterscheiden – Gottesdienste zu besonderen Festtagen und Jubiläen, Gottesdienste an anderen Orten wie zu Pfingsten oder zu Erntedank. Da hat sich vieles neu entwickelt.
Überhaupt „Events“: Besonderes, Anderes wird dankbar angenommen. Ich denke an Beten, Bilder und Buffet, das den Gemeindeausflug, die Johannis-Wanderung ersetzt hat, oder das adventliche „Singen und Erzählen“ in unserer Kirche.
„Begegnung“ ist in Zeiten zunehmender Einsamkeit, wachsender Vereinzelung ein Schlüsselbegriff für Gemeindearbeit. Der Nachmittag der Begegnung spielt für viele eine große Rolle, ebenso – nach dem „Sterben“ der beiden Chöre – der „Chor auf Zeit“. Und auch die Begegnung im vertrauten Seelsorge-Gespräch ist wichtig. In diesem Zusammenhang ist es einerseits schade, dass die Diakonie aus der Gemeinde weitgehend ausgelagert worden ist. Wirkliche Begegnungen einsamer und belasteter Menschen mit anderen aus dem Dorf vertrauten Menschen sind seltener geworden. Andererseits hat sich durch das Diakonische Werk natürlich eine Qualitätssteigerung ohnegleichen ergeben. Bei uns ist es zum Glück so, dass die Dorfgemeinschaft so funktioniert, dass man schon ein Auge auf das Wohlergehen der anderen hat. (Beispiel)
Frauen haben in der Gemeinde schon immer eine Rolle gespielt – oft aber lediglich im Hintergrund. Das hat sich geändert. Der Kirchenvorstand ist längst Frauensache geworden – und das hat der Arbeit gut getan. Wir waren einer der ersten Vorstände, der mit Brunhilde Bertram eine Frau als Vorsitzende hatte. Und dass es zzt. mehr Pastorinnen als Pastoren gibt, hätte vor 30 Jahren auch noch niemand gedacht.
Diese Entwicklung ist vermutlich auch, aber eben nicht nur dem Fachkräftemangel geschuldet, unter dem auch die Kirche leidet. Wir werden sehen, wie lange es dauert, bis unsere Pfarrstelle nach der Pensionierung unseres Pastors im nächsten Jahr wieder besetzt ist.
Der Fachkräftemangel ist es, der auch zu einer grundsätzlichen Überlastung der Pastoren/innen im Dienst führt. Allenthalben müssen über die Gemeindegrenzen hinaus Vertretungsaufgaben wahrgenommen werden.
Eine weitere Folge sind deutliche Veränderungen in der Zusammensetzung der Kirchenvorstände und ihrer Arbeit. Während sich in der Vergangenheit einige Male im Jahr vorwiegend Männer, vorwiegend Landwirte mit einer gewissen Betriebsgröße und andere „Honoratioren“ (Dorflehrer, Arzt …), trafen und die vom Pastor vorbereitete Beschlüsse absegneten, sieht es heute ganz anders aus. Auch eine kleine Gemeinde wie St.Johannis braucht 8 – 10 Sitzungen im Jahr, um die Arbeit einigermaßen zu erledigen. Heute sind es nicht mehr unbedingt die „Angesehenen“, sondern die Engagierten, die im Kirchenvorstand arbeiten, wirklich arbeiten!
Kirchenvorsteher/innen müssen heute erheblich mehr Verantwortung übernehmen und müssen Aufgaben erledigen, die früher selbstverständlich Pastoren/innen (und ihre Sekretärinnen) oder die Kirchenämter wahrgenommen haben. (Beispiele! Exemplar. TO)
Und damit sind wir bei der Verwaltung. Digitalisierung heißt auch hier das Schlagwort. Um wirtschaftlich zu arbeiten, hat man zudem die Verwaltungseinheiten vergrößert. Kirchenkreise wurden zusammengelegt, Gemeinde werden fusioniert - wie wir im nächsten Jahr. Damit vergrößert sich natürlich auch der Zuständigkeitsbereich eines/r Pastors/in. Das geht sicher zu Lasten des Elements der persönlichen Begegnung, wenn darauf nicht sorgsam geachtet wird und Möglichkeiten geschaffen werden. Überraschend „persönlich“ wirken auf mich in diesem Zusammenhang die samstäglichen Video-Andachten unseres Pastors.
Während vor 30 Jahren Kirchenaustritte bei uns kein Thema waren, kommen sie jetzt vor. Zusammen mit der Bevölkerungsentwicklung in unserem Land – zunehmend ältere Menschen, die dann auch am Gemeindeleben irgendwann nicht mehr teilnehmen und schließlich sterben – führt das zu einer Verkleinerung der Zahl der Gemeindeglieder. Das ist für die Verwaltungen natürlich ein weiterer Grund, Gemeinden zusammenzulegen.
Damit verringern sich auch die landeskirchlichen Einnahmen aus der Kirchensteuer – und das ist angesichts steigender Kosten für Löhne und Gehälter und vor allem für die Gebäudeunterhaltung ein handfestes Problem. Unser Glück ist, dass wir durch großzügige Zuwendungen im Rahmen des gemeindebezogenen „Freiw. Kirchenbeitrages“ immer noch sagen können: „Etwas Gutes ist in St.Johannis noch nie am Geld gescheitert!“
In unserem kleinen Dorf haben wir – oft schmerzlich – lernen müssen, dass wir nur gemeinsam bestehen können. Deshalb sieht der Kirchenvorstand seine Arbeit auch unter der Überschrift „Kirche im Dorf“ und sucht deshalb erfolgreich die Zusammenarbeit mit Ortsrat und Vereinen. Auch die Aufgabe des kostenträchtigen Gemeindehauses und der Einzug in das DGH geschah unter diesem Leitgedanken.
Trotz der langjährigen Bemühungen um die Kinderkirche haben wir es auch bei uns mit dem sog. Traditionsabbruch zu tun. Es wachsen weniger an Glaube und Kirche interessierte und engagierte Gemeindeglieder nach. Die Kinderkirche war schwach besucht, zzt. kann sie gar nicht stattfinden. Jugendarbeit haben wir keine. Nach dem Konfirmandenunterricht verabschieden sich viele von der Kirche. Auch der Religionsunterricht in den Schulen fällt oft aus.
Angesichts dieser Situation gilt, Zeichen zu setzen – ganz einfach und praktisch! So arbeiten wir seit einiger Zeit verstärkt mit Licht in der Dunkelheit: Außenbeleuchtung, große, leuchtende Adventssterne vor der Kirche, Strahler (Farbspots) in der Kirche, beleuchtete Mauer zu Heiligabend …
Mehr als eine Äußerlichkeit sind unsere – zeitlich befristeten – Versuche, die Sitzordnung in der Kirche zu variieren. Diese Versuche dienen dem Ziel, schon durch die Sitzordnung mehr Gemeinschaft (durch Blickkontakt) zu schaffen, den Pastor dichter an die Gemeinde heranzuholen.
Wir werden digitaler … Damit erreichen wir nicht unbedingt unsere – ältere – Kerngemeinde, aber wir öffnen uns für Jüngere, die stärker mit dem Internet vertraut und dort regelmäßig unterwegs sind. So haben wir eine Homepage, die Günter Edler aus Bockenem betreut. Unser Friedhof wird digital verwaltet. Man kann uns für Anfragen, Anmeldungen usw. auch über Mail oder WhatsApp erreichen. Im Kirchenvorstand müssen wir nicht erst auf die nächste Sitzung warten. Absprachen, Umlaufbeschlüsse, Protokolle, Einladungen können wir uns nicht mehr ohne digitale Form vorstellen.
Ecclesia semper reformanda – Kirche muss sich ständig verändern. Wir sind auf dem Weg.
Gebet:
Vertraut den neuen Wegen,
auf die der Herr euch weist,
weil Leben heißt: sich regen,
weil Leben wandern heißt.
Seit leuchtend Gottes Bogen
am hohen Himmel stand,
sind Menschen ausgezogen
in das gelobte Land.
Vertraut den neuen Wegen
und wandert in die Zeit.
Gott will, dass ihr ein Segen
für seine Erde seid.
Der uns in frühen Zeiten
das Leben eingehaucht,
der wird uns dahin leiten,
wo er uns will und braucht.
Vertraut den neuen Wegen,
auf die uns Gott gesandt.
Er selbst kommt uns entgegen.
Die Zukunft ist sein Land.
Wer aufbricht, der kann hoffen
in Zeit und Ewigkeit.
Die Tore stehen offen,
das Land ist hell und weit.
(Klaus-Peter Hertzsch, 1989)
Gott, sei du bei uns auf unseren Wegen.