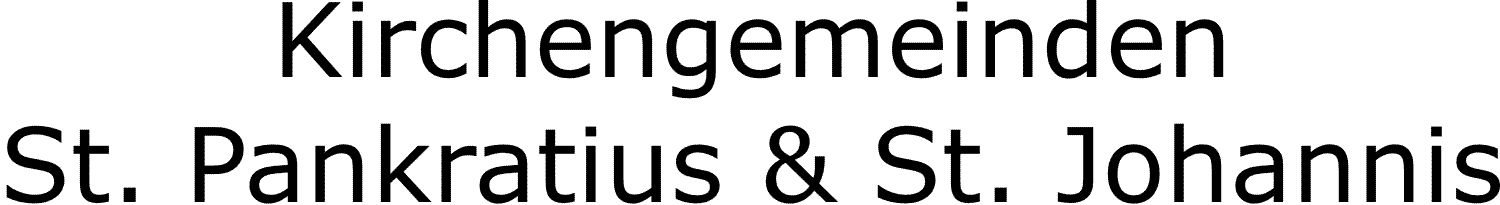385_5nach6_28.06.24_Kirche warum?
Kirche steht in der Kritik. Viele Menschen treten deshalb aus der Kirche aus. Andere haben finanzielle Gründe. Ihnen ist die Kirchensteuer zu hoch. Und wieder andere sagen: „Kirche und Glaube spielen in meinem Leben schlicht keine Rolle.“
Das ist eine Herausforderung für die Kirche. Der muss sie sich stellen.
Vielleicht sollten wir aber auch einmal darauf schauen, warum Menschen eben nicht aus der Kirche austreten!
Genau das hat der Soziologe Jochen Töpfer untersucht (N.Sandrisser, Von wegen Kirchenaustritt, Ev. Zeitung, 13.06.24 – Zitate im Folgenden kursiv).
Er meint: Die Kirchen in Deutschland sollten nach Ansicht des Magdeburger Religionssoziologen besser eine kleinräumige Struktur ihrer Gemeinden erhalten.
Das leuchtet unmittelbar ein. In Königsdahlum haben wir seit Jahrzehnten überwiegend gute Erfahrungen damit gemacht. Je kleiner, desto persönlicher und einfacher ist das Gemeindeleben zu organisieren. Unglücklicherweise gehen wir 2025 einen anderen Weg. Auf „Druck von oben“ schließen wir uns mit St.Pankratius zusammen.
Weiter stellt Töpfer fest: Ein enger Kontakt zu Pfarrerinnen und Pfarrern halte Menschen in der Kirche …: „Für viele Leute ist das am wichtigsten.“
Auch das scheint zu stimmen. Es wird schon darauf geachtet, wen der Pastor besucht – und wen nicht. Das kurze Gespräch an der Kirchentür, beim Gemeindefest oder bei Amtshandlungen, das wird auch von den Königsdahlumern/innen geschätzt.
Dem Pastor, der Pastorin im Alltag zu begegnen ist das eine, das erdet und macht menschlich. Zum anderen vertreten Pastoren/innen eine andere Seite des Lebens, in der sie sprechen und handeln können, was uns anderen, uns sog. Laien, eher schwer fällt. Dabei haben immer noch viele schon eine Ahnung davon, dass diese Seite des Lebens auch bedeutsam ist. Deshalb sind Pastoren und Pastorinnen so wichtig, sind Begegnungen mit ihnen so wichtig.
Unglücklicherweise lebt unser Pastor in Bockenem. Mit der Zusammenlegung der Gemeinden ändert sich das nicht und schon jetzt klagen Pastoren/innen über hohe Belastungen und Fachkräftemangel. Mehr Begegnung zwischen Gemeindegliedern und Pastoren/innen wird kaum möglich sein. So setzt die Landeskirche verstärkt auf die Mitarbeit von ehrenamtlichen Gemeindegliedern.
„Die Kirchen müssten sich interessanter machen für die theologische Ausbildung“, empfahl Töpfer weiter.
Ja, das wäre ein Schritt, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.
Seine Studie habe verschiedene Typen identifiziert (ausgemacht), denen unterschiedliche Dinge wichtig waren.
So gebe es etwa die Gruppe der werteorientierten Gläubigen, denen die Kirchen als Vermittler von gemeinsamen Werten wichtig seien.
Ja! Aber welche Werte sind das? Glaube, Liebe, Hoffnung – aber die Liebe ist die größte unter ihnen (1Kor 13). Denn das ganze Gesetz findet seine Erfüllung in dem einen Gebot (3.Mose 19,18): »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!« (Gal 5,14). Alle weiteren Werte müssen sich daran messen und davon ableiten lassen.
Anderen sei die innere Diversität – also die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Gemeindeglieder - und die Gleichberechtigung in den Kirchen wichtig, erläuterte der Religionssoziologe.
In der Tat – in der Kirche kann man alle treffen: Alte und Junge, Fußballfans und Nicht-Fans, Vereins- und Parteimitglieder und Unorganisierte, Engagierte und Karteileichen …
Und dann die Gleichberechtigung, da sind wir auch schon sehr weit. Frauen als Pastorinnen und Bischöfinnen sind normal geworden. Im Kirchenvorstand erleben wir, dass unser Pastor und wir mit gleichem Stimmrecht ausgestattet sind. Nur in einigen wenigen pastoralen Fragen kann er ohne die Zustimmung des Kirchenvorstandes handeln.
Für die Gruppe der lokal Verankerten wiederum bedeute die Gemeinde eine „Heimat, die die Welt sortiert“ und Festigkeit in einer sich ändernden Welt gebe.
So ist es. Wenn ich nach einer gewissen Zeit der Abwesenheit wieder St.Johannis betrete, stellt sich bei mir ein Heimatgefühl ein. Das bezieht sich nicht nur auf den Kirchraum, sondern auch auf die mehr oder weniger vertrauten Menschen, die ich dort treffe.
Gerade war die „Woche gegen Einsamkeit“ – und auch hier ist Kirche gefragt. Am deutlichsten wird es bei uns beim Nachmittag der Begegnung. Das Bedürfnis nach Gemeinschaft ist unübersehbar – und Kirche kann viel dafür tun, dass Menschen in Einsamkeit und Not nicht allein gelassen sind. Auch Menschen können eine Heimat bieten.
Musikinteressierte sehen kirchliche Musik, Musik in der Kirche als Transportmedium für Glaube und Geschichte ... In diesem Punkt haben wir ja mit Bockenem und Trinitatis im Ambergau ja echte Glanzpunkte anzubieten: von Kindermusical bis Ambergau-Kantorei, von Flötenquintett bis Gospel u.a.m.
Außerdem gebe es eine spirituell orientierte Gruppe, für die Kirchen eine Hilfe zum Selbstfindungsprozess seien.
Verschiedene Gottesdienstformate sind z.B. dafür gut geeignet. Egal, ob der traditionelle Hauptgottesdienst am Sonntagvormittag oder die freitägliche Andacht 5nach6, ob Gottesdienst im Freibad oder feierliche Gottesdienste zu den christlichen Festen oder zu den Konfirmationen und anderen Festen im Lebenslauf – sie alle ermöglichen es, den eigenen Glauben zu entdecken und zu entwickeln.
Die Gruppe der sogenannten Mystiker schätze die Kirchen als Institutionen, die über Jahrtausende Geschichten weitergäben. Diese Gruppe sei in Bezug auf Wandlungsprozesse recht ambivalent, als gespalten: „Sie wissen, dass die Kirchen sich in der heutigen Zeit wandeln müssen, aber sie haben auch Angst, dass das zu schnell passiert“, beschrieb Töpfer diese Gruppe.
Erzählungen und darin enthaltene Werte stiften Glaubensformen. Glaubensformen prägen Lebensformen. Die Weitergabe all dessen nennt man Tradition. Wikipedia sagt:
Tradition (von lateinisch tradere „hinüber-geben… bezeichnet die Weitergabe (das Tradere) von Handlungsmustern, Überzeugungen, Glaubensvorstellungen oder Anderem oder das Weitergegebene selbst (…beispielsweise in Gepflogenheiten, … Bräuche oder Sitten). Tradition geschieht innerhalb einer Gruppe oder zwischen Generationen und kann mündlich oder schriftlich … erfolgen.
Oder eben in gelebter Praxis – wie in der Kirchengemeinde (wenn es gut läuft).
Dabei sind Traditionen und ihre Weitergabe auch Veränderungen unterworden, damit sie für die veränderten Lebenswirklichkeiten auch noch wirksam sein können. Einfachstes Beispiel: Luthers Bibelübersetzung würden wir heute kaum verstehen, deshalb wird der Luthertext in Abständen revidiert, d.h. der Alltagssprache angenähert. Luther wäre der erste gewesen, der das begrüßt!
Tradition ist nicht nur ein fester Bestand an Werten und Formen. Sie ist auch ein Prozess, der das Weiterzugebende und den Weitergabe-Prozess verändert (z.B. Gottesdienstformen, Bibelübersetzungen, neue Kirchenlieder), verändern muss, damit es weiterwirkt. Nichts beschreibt das besser als jenes geflügelte Wort: "Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers."
Weitergeben … der Begriff zeigt eine Bewegung an. Da ist etwas unterwegs von einem zum anderen. Das gilt meines Erachtens auch für die Kirche, auch für unsere St.Johan-nis-Gemeinde. Wir sind unterwegs, das wandernde Volk Gottes.
Wikipedia erklärt: Der Ausdruck wanderndes Gottesvolk geht ursprünglich auf den Kirchenvater Augustinus zurück. … Israel erfährt sich im Alten Testament als von Gott erwählt auf dem Weg zu einem verheißenen Ziel. … Ungeachtet mancher Irrwege, Entbehrungen und Rückschläge erreicht die Wanderung mit Gottes Hilfe ihr Ziel.
Die römisch-katholische Kirche benutzt den Begriff wanderndes Gottesvolk oder pilgerndes Gottesvolk als Selbstbezeichnung. Das Zweite Vatikanische Konzil nahm … (1964) das von Augustinus gefundene Bild auf, wenn es von der Kirche spricht, die „zwischen den Verfolgungen der Welt und den Tröstungen Gottes auf ihrem Pilgerweg“ dahinschreitet und Kreuz, Tod und Auferweckung des Herrn verkündet.
Wie das konkret aussieht?
Zu Pfingsten fahren wir seit über 40 Jahren mit einer Gruppe von Freunden/innen weg. Diesmal waren wir auf der Huysburg, einem kath. Kloster und einer Tagungsstätte nordwestlich von Halberstadt im Harzkreis des Landes Sachsen-Anhalt.
Die Geschichte dieses Klosters zeigt beispielhaft die wechselhaften Wege, die Kirche und Kirchengemeinden zu gehen haben (vgl. Wikipedia).
790 n.Chr. war die Huysburg eine kleine Militärstation der Franken gegen Slawen.
977 wurde daraus durch eine Schenkung ein Hof des Bischofs von Halberstadt.
1070 ließen sich dort Einsiedlerinnen, im Grunde Klosterfrauen nieder. Später siedelten dort Benediktiner-Mönche.
Die Bauernunruhen im 16. Jhdt. schädigten das Kloster schwer.
Im 30-jährigen Krieg des 17. Jhdts. flohen die Benediktiner-Mönche nach Hildesheim.
Im Zuge der Säkularisation wurde 1804 das Kloster Huysburg vom preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. aufgelöst und in eine preußische Domäne umgewandelt.
König Friedrich Wilhelm III. schenkte 1823 seinem späteren General Karl Friedrich von dem Knesebeck die Domäne Huysburg und das Gut Röderhof.
Ab 1826 wurden große Teile des Klosters vom neuen Eigentümer abgetragen. Das Baumaterial diente teilweise zur Errichtung des Schlosses Röderhof in der Gemeinde Röderhof. Die Huysburg blieb Sitz eines Pfarrers und bot Platz für eine Schule.
Ab 1929 wohnten auf der Huysburg Caritasschwestern, die in der Familienseelsorge, Krankenpflege und Jugendarbeit tätig waren.
Die Schule wurde 1939 geschlossen und danach als Ausbildungs- und Wehrertüchtigungslager der Hitlerjugend genutzt.
In den Jahren der sowjetischen Besatzung 1945–1949 war in den barocken Wirtschaftsgebäuden eine Kommandantur untergebracht. Die Gebäude der Huysburg, die in Privatbesitz gewesen waren, wurden 1949 mit einem Pflegeheim belegt.
1952 wurde die Huysburg ein Priesterseminar. Es diente der pastoralen Ausbildung der Theologiestudenten. Seit 1951 gab es Wallfahrten der Gemeinden zur Huysburg. Das Seminar wurde nach der Wiedervereinigung 1993 geschlossen.
Die Deutsche Wiedervereinigung 1990 brachte neue Möglichkeiten. 2004 wurde die Huysburg wieder Sitz einer Mönchsgemeinschaft. Zurzeit (Stand: März 2024) gehören fünf Brüder an. Außerdem sind dort das Pfarrhaus und das Gemeindezentrum einer kath. Pfarrgemeinde und die erwähnte Tagungsstätte.
Was für eine Geschichte! Nach dieser Erfahrung ist mir vor den bevorstehenden Veränderungen für St.Johannis Königsdahlum nicht bange.