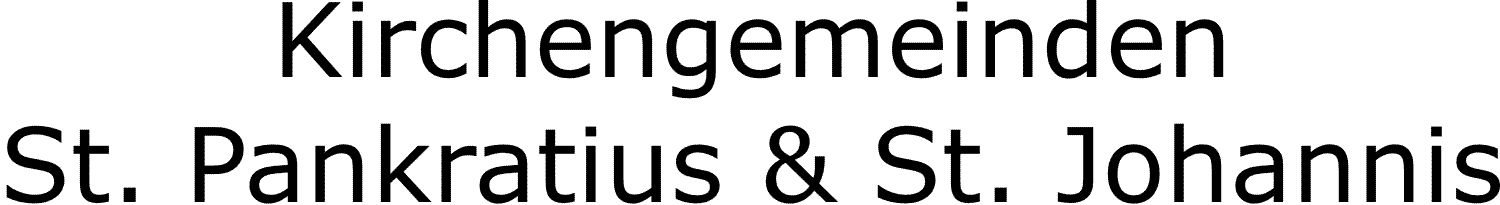446 5nach6_24.10.25_Bitten und beten Ps 139
Quellen: (Zitate kursiv)
- K.H.Röhlin, Evangelische Spiritualität – Gebet, in: N.Dennerlein u.a. (Hg), Evangelischer Lebensbegleiter, Gütersloh, 2007, S.350f
- K.H.Röhlin, Gebet, in: N.Dennerlein, M.Meyer-Blanck(Hg), Evangelische Glaubensfibel, Gütersloh, 2006, S.74f
- K.Ilgenfritz, P.Ziegler, Begegnungen mit Gott, in: Ev. Presseverband Bayern, Thema 3/2024: Glaube im Alltag, S.39ff
Danken – hatten wir. Schenken – hatten wir. Da fehlt ja eigentlich nur noch: BITTEN!
Wenn ich jemanden um etwas bitte, möchte ich von ihm etwas bekommen. Mit dem Wort „bitte“ kann ich jemandem auch etwas anbieten: Bitte nimm doch etwas von meinem köstlichen Kuchen. Aber eigentlich möchte ich ja damit auch etwas von der Person, nämlich dass der Angesprochene nicht nur sich, sondern auch mir den Gefallen tut, ein Stück Kuchen zu nehmen und mir damit ein gutes Gastgeber-Gefühl zu verschaffen.
„Bitte“ ist also ein Beziehungswort, es stiftet eine Beziehung.
Das zeigt auch die Herkunftsgeschichte dieses Wortes. Es hängt in seiner Bedeutung wahrscheinlich zusammen mit „zwingen, drängen, fordern, nötigen, binden“. Wer bittet, schafft eine alles andere als gleichgültige Beziehung, sondern eine intensivere Beziehung, die mit Hoffnungen und Erwartungen an einen anderen verbunden sind.
Im heutigen Sprachgebrauch ist „bitte“ natürlich höflicher und zurückhaltender als „zwingen, drängen, fordern“ oder gar anordnen, befehlen oder verlangen. Wobei da auch der Ton die Musik macht. Wenn meine Frau mit Nachdruck in der Stimme sagt: „Räumst du endlich mal den Geschirrspüler aus, bitte!“, dann ist das schon von einer – sagen wir – bezwingenden Höflichkeit.
Interessant: Der Duden-Band 7 beschäftigt sich mit der Herkunftsgeschichte der Wörter unserer Sprache. Unter dem Stichwort „bitte“ findet sich auch ein Verweis auf das Wort „beten“. Und wenn man es googelt, findet man:
Das Wort "beten" hat seinen Ursprung im Althochdeutschen und ist eine Ableitung von der germanischen Wurzel für "Bitte". Im Zuge der Christianisierung wurde diese ursprüngliche Bedeutung von "Bitte" um den religiösen Aspekt erweitert, … Das Wort "Gebet" stammt ebenfalls daher und bedeutete zuerst einfach "Bitte". Die Bedeutung erweiterte sich hin zu ‘sich in innerer Sammlung an Gott wenden, zu Gott sprechen’.
Woher rührt die große Bedeutung und Wertschätzung des Betens?
Wenn ich Englisch oder Französisch sprechen kann, erschließen sich mir neue Teile der Welt. „Die religiöse Sprache reicht noch weiter. Sie greift über die Grenzen der Alltagswelt hinaus und wendet sich im Gebet an das ‚Ewige Du‘. Dabei vertraut sie darauf, dass Gottes Geist in der Welt und in jedem Menschen gegenwärtig und wirkt.1
Dabei gelingt dieses Wirken mal mehr oder mal weniger, weil Menschen keine ferngesteuerten Rasenmäher-Roboter oder Marionetten sind und dem guten Willen Gottes für uns widerstreben.
Und was ist dieses „Ewige Du“?
Von dem jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber stammt die Aussage: Wenn Gott (nur) jemand wäre, von dem man reden kann, dann würde ich nicht glauben. Weil es aber ein Gott ist, zu dem man reden kann, darum glaube ich an ihn. … Der christliche Glaube wendet sich hin zu dem Gott, den Jesus zeigt. Gott ist für ihn absolut vertrauenswürdig. Fern und nah zugleich, jenseitig und diesseitig, zukünftig und gegenwärtig.1
Gut und schön. Und wenn mein eigenes Schicksal, das Schicksal anderer oder ein Blick in die Zeitung den Verdacht nahelegen, dass es keinen Gott gibt?
Der russische Schriftstellere L.Tolstoi sagt: Wenn du nicht mehr an den Gott glauben kannst, an den du früher geglaubt hast, so rührt das daher, dass in deinem Glauben etwas verkehrt war.1 So stellt er auch lakonisch fest: "Wenn einer an seinen hölzernen Gott zu glauben aufhört, so heißt das nicht, dass es keinen Gott gibt, sondern nur, dass er nicht aus Holz ist."
Zweifel und Verzweiflung können unser Gottvertrauen erschüttern. Es bleibt jedoch die Möglichkeit, den Schmerz und die enttäuschten Hoffnungen ins Gebet zu nehmen.1 Vielleicht ja mit den Worten des Vaters, der Jesus bat, seinen kranken Sohn zu heilen: "Ich glaube; hilf meinem Unglauben!" (Markus 9,24) Dieser Satz drückt unsere Zerrissenheit zwischen Glauben und Zweifel aus.
Und wie bete ich? Im Gebet reden wir zu Gott, so wie uns gerade zumute ist. Die Bibel ermuntert dazu, mit Gott wie mit einem guten Freund oder einer guten Freundin zu sprechen. Alles, was uns bewegt, können wir ihm hinhalten: Freude und Dank, Bitten und Klagen. Erhebende Gefühle müssen uns dabei nicht bewegen. Wir brauchen auch nicht viele Worte zu machen. Allein auf unser Vertrauen kommt es an, dass Gott wie ein guter Vater uns den Rücken stärkt, uns wie eine mitfühlende Mutter versteht.2
Wenn uns eigene Worte fehlen, dann finden wir Zuflucht bei den Gebeten unserer Väter, Mütter und unserer Geschwister im Glauben. Manchmal spüren wir dann, wie Gebete uns verändern. Sie werden zur Lichtspur im Dunkeln. …
Es stimmt: Gebete verändern unseren Lebensstil. Sie verändern das Gesicht der Welt. Wer will, dass alles so bleibt, wie es ist, der sollte nicht beten. Wer jedoch möchte, dass in der Welt die Gerechtigkeit siegt und die bedrohte Schöpfung aufatmen kann, der sollte nicht nachlassen zu beten. … Wenn wir wollen, was Gott will, dann verändert sich durch uns die Welt. … Als 1989 das Ende der DDR eingeläutet wurde, sagte der Leipziger Stasi-Chef: „Wir haben mit allem gerechnet, nur nicht mit Kerzen und Gebeten.“2
Es heißt oft, dass Gott antwortet. Die Antwort muss nicht in Worten bestehen, wie das Beten selbst nicht in Worten bestehen muss.
Bertold Brecht hat dem Beten ein literarisches Denkmal gesetzt:
„Ja, wir können nix machen". Das sagt der Bauer in Brechts „Mutter Courage und ihre Kinder", als die Soldaten kommen und sich anschicken, die nahe Stadt zusammenzuschießen. Dann sagt die Bäuerin zur Tochter, der stummen Kattrin:
„Wir können nix machen gegen das Blutvergießen. Wenn du schon nicht reden kannst, kannst du doch beten. Er hört dich, wenn dich keiner hört." Und dann beten die Bauersleute: „Vater unser, der du bist im Himmel, hör unser Gebet, lass die Stadt nicht umkommen mit allen, die drinnen sind und schlummern und nix ahnen ...". „Gedenke", betet die Bäuerin, „gedenk der Kinder, die bedroht sind, der allerkleinsten besonders, der Greise, die sich nicht rühren können, und aller Kreatur". Und der Bauer schließt: „Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Amen."
In diesem Gebet ist die stumme Kattrin (wie sollte es auch anders sein) stumm geblieben. Doch dann betet die stumme Kattrin selbst. Sie betet nicht stumm, sondern laut – doch nicht in Worten. Ihr Gebet ist ein Trommeln; sie trommelt die Stadt wach, sie trommelt, bis sie von den Soldaten für immer stumm gemacht wird. Die Stadt ist gerettet.
Gebete können aufrütteln, Wege zeigen, Leben verändern.
Im Vorfeld des Reformationstages möchte ich an Martin Luther anknüpfen:
Christen, die beten, sind wie Säulen, die das Dach der Welt tragen! Ein gutes Gebet soll nicht lang sein, auch nicht lange hingezogen werden, sondern es soll oft und herzlich sein. Heute habe ich viel zu tun, darum muss ich viel beten. Wenn ich auch nur einen einzigen Tag das Gebet vernachlässige, verliere ich viel vom Feuer des Glaubens. (Martin Luther über das Gebet)
Abschließend möchte ich uns eine Möglichkeit zu beten nahelegen:
Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit ist ein guter Weg, den Tag abzuschließen. Man blickt auf ihn zurück und bedenkt ihn. Das kann man in sechs Schritten tun:
- Gott – ganz allgemein - für das Gute danken, das ich heute erfahren habe.
Gott bitten, alles ehrlich betrachten zu können, um Fehlern nicht auszuweichen.
Den Tag, ohne zu werten, Stunde für Stunde durchgehen. Mich an Tätigkeiten, Begegnungen und Gefühle erinnern, fragen: Wo war Freude, Ärger oder Trost?
Mit Gott sprechen: ihm danken, ihn um Verzeihung für Fehler, um Trost, Führung (Orientierung) oder Versöhnung bitten.
Vorausblicken auf den nächsten Tag. Was steht an? Gott alle Hoffnungen und Befürchtungen anvertrauen.
Schließen mit einem Vaterunser.
Liebender Gott,
ich möchte Dir Dank sagen,
dass du mich hörst.
Ich weiß, dass Du bei mir bist
in allen Situationen meines Lebens.
Nie muss ich alleine sein, nie einsam.
Du hältst mich
und trägst mich
in Deiner gütigen Hand.
Ich wünsche mir,
dass es
immer so bleibt.
Danke für alles.
Amen